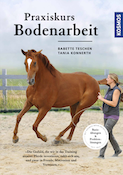Pferde können unsere Gefühle erkennen
Ich freu mich mich immer aufrichtig darüber, wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die bestätigen, wovon ich schon lange ausgehe. Das war vor einiger Zeit zum Beispiel die klare Aussage, dass Dominanz nicht pferdegerecht ist und jetzt wurde von Forschern nachgewiesen, dass Pferde in der Lage sind, unsere Gefühle zu erkennen (hier gibt es einen Artikel in der Süddeutschen dazu und hier geht’s zur Originalstudie).
Was die Forscher erkundeten
Pferde nutzen nach den Erkenntnissen der Forscher verschiedene Aspekte, um unsere Gefühlslage einzuordnen, wie unsere Körperhaltung und -ausstrahlung, Mimik und Stimme. Normalerweise stimmen diese Elemente überein, ein wütender Mensch hat eine entsprechende Körperhaltung, spricht auf eine bestimmte Art und auch seine Mimik spiegelt Wut. Die Forscher prüften nun, was geschieht, wenn etwas davon abweicht.
Was passiert also, wenn das Pferd eine wütende Stimme hört, aber einen freundlichen Menschen sieht? Die Forscher nahmen verschiedene Faktoren in die Wertung, wie „Blickdauer des Pferdes“, „Reaktion“, „Rate des Herzschlags“ und konnten nachweisen, dass sich das Verhalten der Pferde deutlich unterschied, wenn Bild und Stimme widersprüchlich waren als wenn sie übereinstimmten, vor allem dann, wenn ihnen der Mensch vertraut war. Ein solches Verhalten wurde bisher vor allem bei Hunden beobachtet. Aus ihren Beobachtungen leiten die Forscher die Schlussfolgerung ab, dass Pferde in der Lage sind, aufgrund des Gesichtsausdrucks menschliche Emotionen zu erkennen.
Was das für den Umgang mit Pferden bedeutet
Wir schreiben ja immer wieder, für wie wichtig wir es im Umgang mit Pferden halten, dass wir uns über unsere eigene Ausstrahlung bewusster werden und sehen uns nun in unseren Anregungen bestätigt, denn für uns ist ganz klar: Wenn sie schon, wie in der Studie nachgewiesen, eindeutig unsere Mimik lesen können, können sie erst recht unsere Körpersprache und -ausstrahlung interpretieren.
Unsere Erfahrung ist: Pferde reagieren ständig auf uns und werden durch unser Verhalten wesentlich beeinflusst. Tun sie also etwas, was wir nicht wollen oder unschön finden oder reagieren sie anders, als wir es erwartet hätten, gilt es sich zunächst zu fragen, ob wir vielleicht selbst die Ursache für das Verhalten sind:
- Wie wirke ich in diesem Moment auf mein Pferd?
- Was strahle ich gerade aus – und was macht das mit meinem Pferd?
- Welche vielleicht widersprüchlichen Botschaften sende ich?
- Wodurch könnte mein Pferd verwirrt werden?
Tipp: Hier kann es ausgesprochen nützlich sein, sich selbst zu filmen und das später in Ruhe anzuschauen. Da wird einem manches sichtbar gemacht, von dem man keine Ahnung hatte. Auch ein wohlwollender Blick einer vertrauten Person kann hilfreich sein, aber Vorsicht: Die Anwesenheit anderer kann uns angespannt und verkrampft werden lassen, so dass wir dann wieder ganz anders wirken als normalerweise. Eine Kamera, die einfach mitläuft, während wir mit unserem Pferd zusammen sind, zeigt unser gewöhnliches Verhalten oft besser auf.
Der Vorwurf der Vermenschlichung
Viel zu oft hört man noch immer, dass man „Pferde nicht vermenschlichen“ soll und rechtfertigt damit Ignoranz, einen groben Umgang und ein unfaires Verhalten. Dabei wird aber leider übersehen, dass „vermenschlichen“ und „menschlich sein“ zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind…
Wir vermenschlichen ein Pferd keineswegs, wenn wir seine hoch entwickelten Sozialfähigkeiten anerkennen und begreifen, wie empfindsam sie sind – im Gegenteil, nur dann können wir wirklich pferdegerecht reagieren.

26. Juni 2018 von Tania Konnerth • Kategorie: Engagement und Pferdeschutz, Erkenntnisse, Umgang, Verhalten • 3 Kommentare »



 Dann wurde das Wasser angestellt und – ganz wichtig!!! – der Wasserstrahl erst einmal WEG von Nico gehalten. Drehen Sie das Wasser erst mal nur wenig auf. So konnte Nico sich die Sache in Ruhe anschauen, ohne sich bedroht zu fühlen. Bei sehr ängstlichen Pferden sollte ruhig eine zweite Person den Schlauch mit einem noch deutlich größeren Abstand vom Pferd weghalten. Auch hier wieder jedes noch so kleine Interesse an dem Geschehen loben! Nico hingegen fand das, was Alex da machte, ziemlich interessant:
Dann wurde das Wasser angestellt und – ganz wichtig!!! – der Wasserstrahl erst einmal WEG von Nico gehalten. Drehen Sie das Wasser erst mal nur wenig auf. So konnte Nico sich die Sache in Ruhe anschauen, ohne sich bedroht zu fühlen. Bei sehr ängstlichen Pferden sollte ruhig eine zweite Person den Schlauch mit einem noch deutlich größeren Abstand vom Pferd weghalten. Auch hier wieder jedes noch so kleine Interesse an dem Geschehen loben! Nico hingegen fand das, was Alex da machte, ziemlich interessant: 




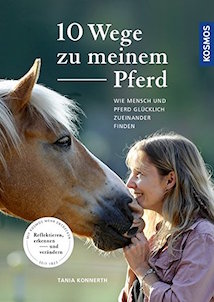 In diesen Tagen ist mein Buch „10 Wege zu meinem Pferd“ erschienen. Ich habe zwar schon einige Bücher geschrieben, aber dieses ist ein ganz besonderes und deshalb möchte ich hier noch ein bisschen etwas über die Entstehung mit Euch teilen.
In diesen Tagen ist mein Buch „10 Wege zu meinem Pferd“ erschienen. Ich habe zwar schon einige Bücher geschrieben, aber dieses ist ein ganz besonderes und deshalb möchte ich hier noch ein bisschen etwas über die Entstehung mit Euch teilen. In diesem Buch steckt sehr viel von mir und noch mehr von meinen Pferden. Das Fundament bildet mein Aramis, der im letzten Jahr starb, noch bevor ich mit dem Buch begonnen hatte. Achtzehn gemeinsame Jahre durfte ich mit ihm erleben und vieles in meinem Denken, Fühlen und Tun im Zusammenhang mit Pferden ist geprägt durch das, was er mir schenkte und was ich mit ihm erleben durfte. Er lebt als Mentor und guter Geist ein Stück weit auch durch dieses Buch weiter.
In diesem Buch steckt sehr viel von mir und noch mehr von meinen Pferden. Das Fundament bildet mein Aramis, der im letzten Jahr starb, noch bevor ich mit dem Buch begonnen hatte. Achtzehn gemeinsame Jahre durfte ich mit ihm erleben und vieles in meinem Denken, Fühlen und Tun im Zusammenhang mit Pferden ist geprägt durch das, was er mir schenkte und was ich mit ihm erleben durfte. Er lebt als Mentor und guter Geist ein Stück weit auch durch dieses Buch weiter.