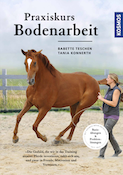Das Abspulen – ein typisches Problem bei der Freiarbeit
Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich auch mal mit einem anderen als meinen eigenen Pferden arbeiten darf, denn dadurch lerne ich sehr viel. Neulich hatte ich eine kleine Freiarbeit-Einheit mit Babettes Ronni machen dürfen, die mich gleich zu einem neuen Blogbeitrag inspiriert hat.
Ronni gerät sehr schnell in Stress. Er möchte alles richtig machen und reagiert unter Druck schnell panisch. Als ich ihn zur Freiarbeit einlud, zirkelte er sofort um mich herum, trabte in Stellung, galoppierte an und zeigte sein ganzes Repertoire. Das war sehr hübsch anzuschauen und auch rührend, wie er da als kleiner Oberstreber um mich herumschwebte und es wäre verlockend gewesen, das anzunehmen. Statt dessen brach ich die Einheit aber sehr schnell ab und führte ihn noch einige Runden am Strick herum, lobte ihn dafür und brachte ihn wieder hinaus.
Der Grund, warum ich nicht weiterarbeitete, war der, dass mir Ronni nicht zuhörte. Er tat das, was ich „Abspulen“ nenne und tatsächlich ist das ein häufiges Phänomen in der Freiarbeit: Besonders unsichere Pferde bieten das, was ihnen „sicher“ erscheint, ohne dabei aber auf den Menschen und seine Signale zu achten. Ronni kannte durch Babette schon die Freiarbeit und kann sehr viel. Das alles bot er mir an, aber in dieser Situation nicht aus Freude, sondern vor allem aus Unsicherheit. Es ist wichtig, das zu erkennen. (Eine andere, häufigere Version des Abspulens ist die, dass das Pferd einfach nur auf dem Hufschlag Runde um Runde herumläuft und sich nicht zum Verkleinern einladen lässt, manchmal sogar schwer anzuhalten ist. Es läuft und läuft und läuft – nicht weil es stur ist, sondern weil es unsicher ist und das das einzige ist, was ihm in diesem Moment einfällt.)
Miteinander heißt aufeinander zu reagieren
Mein Ziel bei der Freiarbeit ist ein Miteinander. Ich möchte in Kommunikation mit dem Pferd treten, möchte, dass es auf mich reagiert und wünsche mir, eine Art Dialog zu führen. Mit einem Pferd, das nur abspult, kann ich nicht kommunizieren, schlicht und einfach, weil es nicht bereit zum Zuhören ist.
Wenn ein Pferd Runde um Runde einfach nur läuft, ohne auf meine Signale zu hören, ist das Abspulen relativ leicht zu erkennen. Aber bei einem Pferd wie Ronni, das ganz vieles anbietet, ist es schwieriger. In der Freiarbeit begrüßen wir ja auch eigene Ideen und Vorschläge vom Pferd, wie erkenne ich also, ob ein Pferd aus Eigeninitiative einen Galopp vorschlägt oder weil es glaubt, das jetzt tun zu sollen? Indem ich sehr genau auf das Pferd achte.
Ich frage mich immer:
- Kann ich das Pferd fühlen? Sind wir in Kontakt?
- Fühlt es sich nach einem echten Miteinander an oder eher so, als würde jeder „sein Ding“ machen?
- Hat das Pferd eine freudige, kraftvolle Energie oder zeigt sein Blick Sorge oder Stress oder wirkt es in sich gekehrt?
- Wirkt das Pferd konzentriert und engagiert oder eher gelangweilt und lustlos oder gar gestresst und besorgt?
- Reagiert das Pferd auf meine Signale oder ignoriert es mich?
Wenn ich mit einem Pferd wie Ronni arbeite, ist das im ersten Moment beglückend, weil alles gleichsam wie von selbst klappt. Aber genau das ist für mich nicht Sinn der Freiarbeit. Ich will keine Maschine, ich möchte Kontakt – gerade in der Freiarbeit! Ich möchte spüren, was das Pferd mag, was ihm schwer fällt, wo es sich anstrengen muss und was es ganz locker kann. Ich möchte mich einstellen können auf die Hilfengebung und möchte das Gefühl von Zweisamkeit haben. Ich ziele darauf, mit dem Pferd gemeinsam zu tanzen und nicht, dass es vortanzt.
Mein Anthony hat mich gut in Sachen Verbindung geschult: Er fordert bei der Freiarbeit voll und ganz meine Präsenz. Wenn ich nur halb anwesend bin, macht er schnell sein eigenes Ding. Bin ich nachlässig, stellt Anthony sich dann beispielsweise nach außen oder läuft ganze Bahn, wechselt die Richtung usw. Wenn ich hingegen wirklich da und mit ihm in Kontakt bin, lässt er sich mit minimalem Einsatz wundervoll in Stellung und Biegung arbeiten, vom Tempo und der Gangart regulieren und wir können ganz butterweich Volten vergrößern und verkleinern oder Handwechsel machen.
Hier ist schön zu sehen, wie er mit einem Ohr ganz bei mir ist – eine solche Aufmerksamkeit ist für mich die Basis einer gelungenen Freiarbeit (beim Pferd, aber auch beim Menschen!).

Berichtet doch mal, ob Ihr das, worüber ich hier schreibe, auch selbst kennt. Mein Eindruck ist, dass das Abspulen nicht nur ein Phänomen der Freiarbeit ist, aber da zeigt es sich für mich ganz besonders deutlich. Denn was oft so „magisch“ aussieht und vielfach bewundert und bestaunt wird, nämlich ein Pferd das scheinbar mit Gedanken gelenkt wird und perfekt funktioniert, macht zu Showzwecken sicher etwas her, aber genau das hat für mich eben nur wenig bis gar nichts mit FREIarbeit zu tun.
Lesetipp: Tanias Freiraum-Training
17. Mai 2016 von Tania Konnerth • Kategorie: Freiarbeit, Verhalten • 9 Kommentare »







 Anscheinend konnte Buddy diesen Reifen einfach nicht in seinem Maul drehen. Also gab er nach einigen Versuchen auf. Bei meinem nächsten Besuch bei Buddy suchte ich nach einem anderen Reifen, einen, der keine abgeflachten Kanten hat, sondern schön rund ist (s. oben der graue Reifen) und sofort war Buddy wieder Feuer und Flamme und schmiss sich den Reifen gekonnt über den Hals!
Anscheinend konnte Buddy diesen Reifen einfach nicht in seinem Maul drehen. Also gab er nach einigen Versuchen auf. Bei meinem nächsten Besuch bei Buddy suchte ich nach einem anderen Reifen, einen, der keine abgeflachten Kanten hat, sondern schön rund ist (s. oben der graue Reifen) und sofort war Buddy wieder Feuer und Flamme und schmiss sich den Reifen gekonnt über den Hals!