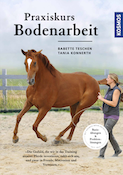Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das meiner Einschätzung nach viele Pferdemenschen bewegt, das aber nur selten offen behandelt wird. Und zwar geht es um enttäuschte Erwartungen.
Beispiele
- Silvia hat sich für viel Geld ein junges, vielversprechendes Dressurpferd aus einer bekannten Zuchtlinie gekauft. Ihr Ziel war, mit diesem Pferd sportliche Erfolge zu erzielen. Es stellt sich allerdings heraus, dass das Pferd sehr sensibel und von seinem Nervenkostüm her wenig belastbar ist. Es scheut auf den Turnierplätzen und regt sich oft so auf, dass die Prüfung abgebrochen werden muss.
- Lutz möchte zusammen mit seiner Frau ausreiten und kauft sich einen Tinker, der als Verlasspferd angeboten wurde. Als Reitanfänger hat er noch nicht allzu viel Erfahrung mit Pferden und ist schnell überfordert, als sich der Tinker als rüpelig und futterfordernd herausstellt. An ein ruhiges Ausreiten ist kaum zu denken, da das Pferd bei der erstbesten Gelegenheit stehenbleibt und Gras frisst. Beim Spazierengehen wird Lutz durch die Gegend gezogen.
- Andrea hat für sich und ihre Tochter ein schon etwas älteres Springpferd gekauft, da beide gerne auf die Turniere im Landkreis gehen wollen. Nach einem halben Jahr geht das Pferd lahm, der Tierarzt diagnostiziert einen Chip.
- Danas Traum war es immer schon, einmal ein eigenes Jungpferd auszubilden. Sie kauft sich einen dreijährigen Isländer, den sie gemeinsam liebevoll und verständig mit einer Trainerin ausbildet. Trotz allem verweigert das Pferd beharrlich, geritten zu werden, indem es sich massiv gegen jeden Reiter wehrt.
All das sind offensichtliche Beispiele von Pferd-Mensch-Beziehungen, die anders laufen, als der Mensch sich das gedacht hat, und es gibt viele weitere solcher Geschichten. Verständlicherweise sind Silvia & Co enttäuscht.
Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Enttäuschungen dieser Art um?
Manch einer wird in einem solchen Fall das Pferd verkaufen und es mit einem anderen versuchen. Andere halten an ihren Zielen fest und probieren alles Mögliche, um zu erreichen, was sie wollen. Wieder andere versuchen Kompromisse zu finden, indem sie ihre Erwartungen herunterschrauben und sehen, was möglich ist.
Auch wir hatten Erwartungen an unsere Pferde und nicht alle dieser Erwartungen wurden erfüllt. Damit sind wir ganz unterschiedlich umgegangen: wir waren frustriert und traurig, wir haben verschiedenste Methoden gewählt, um zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben und ja, auch wir haben unsere Erwartungen verändert.
Es gibt aber noch einen anderen Gedanken.
Dürfen wir überhaupt etwas erwarten?
Was für uns fundamental etwas im Umgang mit Pferden verändert hat, war die Frage, ob es eigentlich okay ist, überhaupt feste Erwartungen an unsere Pferde zu haben.
Die Frage, ob wir tatsächlich ein Recht haben, von unserem Pferd zu verlangen, was wir wollen, ist eine heikle, denn die meisten Menschen schaffen sich ja ein Pferd an, weil sie etwas Bestimmtes vorhaben: sie wollen das Pferd nutzen, also reiten, fahren, Vorführungen machen usw. Und klar, Wünsche und Träume darf jeder haben, aber eine Erwartung geht deutlich weiter: Wenn wir etwas erwarten, WOLLEN wir es, und je nach Typ und Persönlichkeit werden wir sehr viel daran setzen, es auch zu bekommen. Und genau da werden die eigenen Interessen viel zu oft auf Kosten der Pferde und häufig unter Einsatz von Gewalt verfolgt.
Meine Pferde haben mir beide auf ihre Art Lehrstücke in Sachen Erwartungshaltung geschenkt. Vor allem aber war es Anthony, der mir klar machte, dass ich kein Recht habe, von ihm etwas zu wollen, das er mir nicht geben kann oder will. Ich habe mit ihm viel erreicht – bis er sich dann entschied, immer weniger geben zu wollen. Er entzog mir nach und nach so ziemlich alles, was ich mir mit ihm und von ihm gewünscht hatte und während ich das lange Zeit als ziemlich schmerzlich empfand und auch sehr damit haderte, so erkenne ich heute, dass er mir damit etwas Kostbares geschenkt hat.
Ich habe nämlich erst durch ihn das gelernt, was eigentlich selbstverständlich für jeden sein sollte, der Pferde liebt: dass wir tatsächlich kein Anrecht darauf haben, Pferde zu etwas zu bringen, was wir von ihnen erwarten, sondern dass wir ihre Vorstellungen, ihre Persönlichkeit und ihr eigenes Sein respektieren müssen.
Es geht um ein Mitspracherecht
Es geht mir hier nicht um die immer wieder vorgebrachte Diskussion darüber, dass man Pferden ja ihren Willen nicht lassen kann, da sie sonst auf Straßen rennen oder Menschen gefährden. Ganz klar: Eine Grunderziehung muss sein, da sonst ein sicherer Umgang mit einem Pferd nicht möglich ist. Mir geht es hier um das, was darüber hinaus geht, also um alles, was wir zu unserem eigenen Vergnügen von unseren Pferden wollen.
Natürlich können anfragen und anbieten, wir können verlocken und motivieren, aber wir dürfen meiner Ansicht nach Pferde nicht zwingen – nicht zum Reiten, nicht zum Springen, nicht zu Zirkuslektionen usw. Vor einiger Zeit hätte ich das sicher noch etwas anders gesehen und hätte damit argumentiert, dass ein Pferd ja auch wegen der Gesunderhaltung trainiert werden muss und dass ja das, was ich vorhabe, eben auch gut fürs Pferd sei … Heute weiß ich, dass diese Argumente zu einem großen Teil dafür dienten, dass ich mein Ding durchziehen und meine Erwartungen nicht loslassen wollte.
Ein Pferd wirklich zu lieben, bedeutet für mich heute, ihm ein ganz klares Mitspracherecht einzuräumen, es anzunehmen wie es ist und auch zu akzeptieren, wenn es meine Erwartungen nicht erfüllt. Pferde sind eben genau nicht dafür da, sondern Pferde sind einfach nur Pferde. Wenn wir von einem Pferd enttäuscht sind, ist es nicht sein Fehler, sondern die Ursache liegt bei uns, in unseren Erwartungen. Wenn wir bereit sind, sie loszulassen, können wir unser Pferd so wertschätzen, wie es ist.




 Anscheinend konnte Buddy diesen Reifen einfach nicht in seinem Maul drehen. Also gab er nach einigen Versuchen auf. Bei meinem nächsten Besuch bei Buddy suchte ich nach einem anderen Reifen, einen, der keine abgeflachten Kanten hat, sondern schön rund ist (s. oben der graue Reifen) und sofort war Buddy wieder Feuer und Flamme und schmiss sich den Reifen gekonnt über den Hals!
Anscheinend konnte Buddy diesen Reifen einfach nicht in seinem Maul drehen. Also gab er nach einigen Versuchen auf. Bei meinem nächsten Besuch bei Buddy suchte ich nach einem anderen Reifen, einen, der keine abgeflachten Kanten hat, sondern schön rund ist (s. oben der graue Reifen) und sofort war Buddy wieder Feuer und Flamme und schmiss sich den Reifen gekonnt über den Hals!