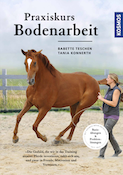Ich kaue weiter auf dem schwierigen Thema herum, wie man mit Unrecht gegenüber Pferden umgehen soll. Die zahlreichen Reaktionen, die wir auf den letzten Artikel dazu bekommen haben, zeigen, dass sich sehr viele hilflos fühlen, wenn sie etwas sehen, unter dem Pferde leiden und dass die wenigsten wissen, wie man damit am besten umgehen kann, sowohl im eigenen Stall als auch draußen. Was ich glaube, was uns allen fehlt, ist eine konstruktive Streitkultur oder wenigstens eine Handvoll Regeln für die Kommunikation, denn Kommunikation ist der Schlüssel zum Verstehen.
Vielleicht bin ich mal wieder hoffnungslos naiv, aber ich habe ein Bild im Kopf von einem anderen, einem besseren Umgang miteinander, von dem wir Menschen und damit auch die Pferde profitieren würden.
Für den Anfang habe ich hier mal drei Regeln zusammengestellt, die meiner Einschätzung nach sehr vieles verändern könnten:
Regel 1: Es geht um die PFERDE!
Diese Regel scheint leider sehr schwer zu vermitteln zu sein, aber sie könnte Grundlegendes zum Guten verändern.
Aus meiner Sicht liegt das Hauptproblem in der Kommunikation in Ställen darin, dass sich jeder sofort persönlich angegriffen fühlt. Selbst eine neutrale Nachfrage wird oft sofort als Kritik aufgefasst, die Äußerung einer anderen Idee als Affront und auch konstruktive Kritik geradezu als Kriegserklärung.
Aber muss das wirklich so sein? Es sollte doch eben gerade nicht um UNS gehen, sondern um die Pferde und genau das müsste doch im Interesse aller Pferdemenschen sein! Wenn wir die Pferde konsequent in den Fokus stellen, wird vielleicht möglich, auch in Ställen Gespräche zu führen, von denen alle profitieren.
Lassen wir uns doch für den Moment einmal auf diese Vision ein: Was würde wohl passieren, wenn wir alle davon ausgehen würden, dass für jeden im Stall das Wohl der Pferde oberste Priorität hat. Das würde bedeuten, dass wir annehmen können, dass also jeder, der etwas sagt, seinen Blick konsequent auf dem Pferd hat und dass er oder sie vielleicht tatsächlich etwas sieht und wahrnimmt, für das ich in diesem Moment vielleicht blind bin?
Wow, würde ich dann vielleicht nicht ganz anders damit umgehen, wenn mir jemand etwas sagt? Schließlich will ich doch das Beste für mein Pferd, oder etwa nicht?
Ja, diese Regel fordert von uns, unser Ego zurückzunehmen und verletzte Gefühle und Eitelkeiten, eigene Erwartungen, Schuldgefühle und dergleichen mehr, wenigstens für einen Moment hinter die Frage zu stellen:
Ist das, was ich gerade tue oder entscheide,
wirklich gut für mein Pferd?
Es geht bei dieser Idee nur um dieses Innehalten, nicht darum, dass man seinen eigenen Weg und seine eigenen Ansichten komplett über den Haufen werfen soll, nur weil mal jemand etwas sagt. Es geht allein um die kleine Pause, die ermöglicht, einen Schritt zur Seite zu machen und das eigene Tun zu reflektieren – was uns direkt zur zweiten Regel bringt:
Regel 2: Ständige Bereitschaft zur Selbstreflexion
Pferdeställe sind leider Orte, an denen die wenigsten bereit sind, voneinander zu lernen, sondern in denen die meisten (aus welchen Gründen auch immer) davon ausgehen, genug zu wissen und alles richtig zu machen. Nun gibt es aber niemanden, wirklich niemanden, der keine Fehler macht und es gibt niemanden, der nichts mehr dazulernen kann (wenn wir ehrlich sind, wissen wir das auch ganz genau).
Für mich gehört inzwischen die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, das eigene Tun zu hinterfragen, nicht nur, aber gerade in Pferdeställen zu dem Wichtigsten, was vermittelt werden kann. In vielen Lernsituationen herrscht immer noch das Lehrerprinzip: Einer sagt, was richtig ist und alle müssen es übernehmen – genauso wird es traurigerweise immer noch oft im Reitunterricht praktiziert. Wir brauchen aber eine offene Lernatmosphäre, in der Fragen erlaubt sind, in der Fehler eingestanden, in der wir ausprobieren dürfen und Verhalten geändert werden kann.
Gerade Reitlehrer müssten Vorbilder in Sachen Selbstreflexion sein, denn sie ist der einzige Garant dafür, dass wir Fehler nicht ständig wiederholen, dass wir fair bleiben und auf unser Gegenüber (also unser PFERD) eingehen können. Wer nicht bereit ist, sich selbst zu reflektieren, wird sehr schnell selbstherrlich – und diese Selbstherrlichkeit ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme in Pferdeställen und vor allem die Aggression, die aus ihr entsteht, wenn jemand an ihr zu kratzen wagt. Denn, wenn uns jemand auf unser Verhalten anspricht und wir nicht bereit sind, kurz nachzuspüren, ob vielleicht etwas an dem Gesagten dran sein könnte, sondern uns nur angegriffen fühlen, reagieren viele von uns reflexartig und schlagen zurück – oft ohne überhaupt genau verstanden zu haben, was gesagt und gemeint wurde. Wenn wir aber versuchen würden, erst einmal zu verstehen, was die Person uns sagen will, würden wir die automatische Reaktion unterbrechen können und wir würden unser Verhalten zu reflektieren beginnen.
Es geht, wie schon gesagt, überhaupt nicht darum, dass man all das, was man gelernt hat, weiß und tut, über den Haufen werfen muss. Aber es geht darum, offen zu bleiben für die Anregungen und Ansichten andere, für Feedback und Rückmeldungen und vor allem für Weiterentwicklung und Dazulernen. Und dafür braucht es eine viel vertrauensvollere Umgebung, als sie bisher in der Regel in Reitställen herrscht. Die vielleicht entscheidendste Ursache dafür führt mich zu Regel Nummer drei:
Regel 3: Nicht über- sondern MITeinander reden
Diese Regel ist aus meiner Sicht ebenfalls unerlässlich, weil sie überhaupt erst so etwas wie Offenheit und ja, im Idealfall sogar Vertrauen ermöglicht. Und zwar geht es darum, dass wir nicht über andere reden, sondern MIT ihnen.
Keine Frage, es ist oft viel leichter, anderen von dem „Mist“ zu erzählen, den jemand verzapft und wie „doof“ jemand ist oder wie brutal – aber, und darüber sind sich viele leider nicht wirklich bewusst: das Reden über andere vergiftet alles.
Aus meiner Sicht ist es nur dann angemessen und unter Umständen auch sinnvoll, über jemanden zu reden, wenn mehrere sich zusammen tun wollen, um aktiv (und hoffentlich konstruktiv) gegen jemanden vorzugehen, der unbelehrbar immer wieder Schlimmes tut. Eine solche Absprache hat aber nichts mit Lästern zu tun. Lästern sollte immer tabu sein, denn Lästern ist der Nährboden für Angst, Misstrauen, Missgunst und vieles mehr. Und darunter leiden alle.
Ich habe mich immer gefragt, was dieser Spruch „Das Leben ist kein Ponyhof“ eigentlich bedeuten soll, denn er suggeriert, dass Ponyhöfe eine heile Welt sind. Jeder, der normale Reitställe von innen kennt, weiß, dass in den meisten Fällen genau das Gegenteil der Fall ist: Lästereien, Missgunst und Mobbing gehören häufig zur Tagesordnung und das ganz sicher, weil immer eher über andere und eben nicht MITEINANDER geredet wird. Wie sollen da konstruktive Gespräche zustande kommen, wie soll man da voneinander lernen und offen für Anregungen sein? Nur wenn wir mutig werden, auf andere Pferdemenschen zuzugehen und etwas von uns selbst zu zeigen, nämlich z.B., was in uns vorgeht, was wir denken und fühlen und ja, auch unsere eigenen Fehler und Unsicherheiten und Fragen, werden sich auch andere öffnen können.
Um diese Regel umsetzen zu können, brauchen wir alle eine gute Portion Kommunikations-Knowhow, denn viele von uns wissen nicht wirklich, wie man überhaupt Gespräche konstruktiv führen kann. So etwas wird natürlich nicht im Reitunterricht gelehrt (und leider eben oft auch nicht in der Schule oder daheim). Sich hier gewisse Schwächen einzugestehen, ist der erste Schritt, sich mit der Frage zu befassen, was Kommunikation eigentlich ausmacht und wie man konstruktiv und respektvoll mit anderen Menschen reden kann. Es gibt dazu viele Modelle und Anregungen und es wird dazu auch bei „Wege zum Pferd“ noch den einen oder anderen Beitrag zu lesen geben.
Und gerade was diesen Punkt angeht, also mehr über das zu lernen, was eine gute Kommunikation ausmacht und achtsamer im Umgang mit anderen Menschen zu werden, das ist genau das, was sich meiner Ansicht nach auch unmittelbar positiv auf unser Verhalten gegenüber Pferden auswirken wird.
Was meint Ihr, wollen wir es versuchen?

 (Foto von Lisa Wolpers)
(Foto von Lisa Wolpers)