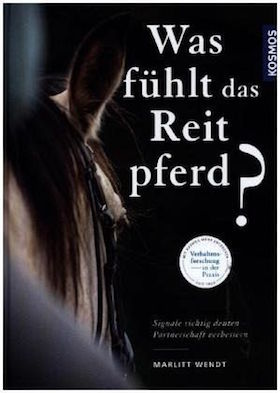Das Schnappen eines Pferdes sorgt nicht nur für viel Unruhe im Miteinander, sondern bereitet vielen Pferdemenschen auch Sorgen, denn keiner möchte schließlich einen Beißer haben. Da wir selbst reichlich Erfahrung mit schnappenden Pferden haben, haben wir hier einmal einen kleinen Problemlösungsplan erstellt.
Hinweis: Das Schnappen oder die Angst davor, dass ein Pferd zu schnappen beginnen kann, ist auch ein häufiger Grund, warum viele davon absehen, ihr Pferd nach dem Clickertraining auszubilden. Tatsächlich aber ist das Clickern fast nie der Grund für das Schnappen, sondern es macht nur das schon bestehende Problem sichtbarer. Die folgenden Tipps beziehen sich auf den Umgang sowohl für nicht-clickernde als auch für clickernde Pferdemenschen.
Check: Warum schnappt das Pferd?
Zu Beginn eines jeden Problems steht für uns die Frage: Warum macht das Pferd das?
Das Schnappen kann ganz verschiedene Gründe haben:
Zunächst gehört das Schnappen in gewissem Grad zum ganz normalen Verhalten von Pferden und ist vor allem für männliche Pferde schlicht und einfach typisch. Pferde erforschen die Welt mit ihrem Maul und viele Spiele untereinander sind „Maulspiele“. Indem wir das Verhalten nicht grundsätzlich als „Unart“ interpretieren, sondern zunächst einfach als ganz natürliches Verhalten, können wir ganz anders damit umgehen.
Bei dieser Art des natürlichen Schnappens wirkt das Pferd verspielt oder auch nervig-aufdringlich, aber nicht aggressiv. Wird das Schnappen schärfer oder wirkt es wie eine Drohung, müssen wir in andere Richtungen denken:
- Steht das Pferd vielleicht unter Stress? Sind die Erwartungen, die wir gerade haben, vielleicht zu hoch, die Anforderungen zu schwer? Fürchtet das Pferd, bestraft zu werden, wenn es nicht tut, was es soll? Hat es vielleicht Schwierigkeiten zu verstehen, was von ihm gefordert ist? Auf Unsicherheit, Verwirrung, Angst und Stress reagieren viele Pferde mit Schnappen.
- Hat das Pferd ausreichend artgerechte Bewegung und Kontakt mit Artgenossen? Pferde, die ihre natürlichen Bedürfnisse nicht mit anderen Pferden ausleben können, lassen diese oft am Menschen aus, einfach, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt.
- Ein sehr penetrantes Schnappen kann auch ein Zeichen dafür sein, dass das Pferd Hunger hat. Viele Pferde bekommen zu wenig Raufutter und haben deshalb ständig Hunger. Wenn wir nun mit ihnen arbeiten wollen, fällt es ihnen schwer, sich zu konzentrieren, stattdessen äußern sie ihren Unmut durch Verhaltensweisen wie das Schnappen. Kommt bei einem hungrigen Pferd Futterlob als positiver Verstärker hinzu, kann es verständlicherweise gierig reagieren.
- Wird das Schnappen zunehmend aggressiv, ist auch an Schmerzen zu denken. Ein Beispiel dafür ist das Schnappen beim Satteln und Nachsatteln. Das Schnappen oder Beißen kann hier ein klares Zeichen des Pferdes sein, dass ihm der Sattel unangenehm ist oder sogar wehtut. Manchmal führen auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit zu dauerhaften Drohgebärden, weil das Pferd so etwas nicht mehr erleben will.
Tipp: Es kann sehr hilfreich sein, einmal eine neutrale Person zu befragen, welchen Eindruck das Pferd macht oder sich das Miteinander mit etwas Abstand auf einem Video anzuschauen. In der Situation selbst erlebt man ein Verhalten oft ganz anders, als wenn man von außen darauf schaut.
Strafen ist aus unserer Sicht der falsche Weg
Viele haben Angst, dass ein schnappendes Pferd zu einem Beißer wird, wenn sie das Schnappen nicht bestrafen. Und so wird jedes Mal, wenn das Pferd schnappt, drohend „Lass das!“ gezischt oder das Pferd bekommt einen Klaps auf die Nase. In den wenigsten Fällen lassen sich schnappende Pferde dadurch vom Schnappen abhalten, im Gegenteil, man kann den Eindruck bekommen, dass genau diese Aufmerksamkeit durch den Menschen viele Pferde geradezu herausfordert, erst recht zu schnappen. Und so verbringen nicht wenige Pferd-Mensch-Paare viel Zeit damit, dass der eine schnappt und der andere schimpft und klapst. Wirklich glücklich ist damit keiner, aber es scheint kaum einen Ausweg auf dem Dilemma zu geben, schließlich kann man dem Pferd das nicht durchgehen lassen!? Das gesetzte Fragezeichen ist entscheidend, denn unserer Erfahrung nach macht es in den allermeisten Fällen tatsächlich viel mehr Sinn, auf das Schnappen nicht einzugehen, als es zu bestrafen. Dazu gleich mehr.
Schauen wir uns zunächst noch kurz an, was oft passiert, wenn ein Mensch mit einem eh schon schnappenden Pferd zu clickern beginnt: Wenn Futter ins Spiel kommt, werden viele Pferde aufgeregt. Und unter Aufregung verstärken sich bestimmte Verhaltensweisen, wie eben auch das Schnappen. Wenn der Mensch nun auch noch inkonsequent in der Futtergabe ist, also mal nach dem Click füttert, mal aber nur, weil das Pferd so süß ist oder wenn es ihn gerade bedrängt oder um es zu bestechen, dann kann es sehr gut dazu kommen, dass das Schnappen stärker wird. Straft der Mensch dann stärker oder zieht er die Hand mit dem Futter weg, weil er fürchtet, gebissen zu werden, kann damit genau das provoziert werden: Auch das Pferd wird schneller und beißt unter Umständen auch mal zu.
Erkennen, mit welcher Art Schnappen man es zu tun hat
Wie schon ausgeführt gehört das Schnappen mit zum natürlichen Verhaltensrepertoire von Pferden und so sollten wir es auch sehen: Es kann eine spielerische Geste sein oder auch Ausdruck von Stress oder Unsicherheit. Und diesen Unterschied müssen wir erkennen!
Der Situation angemessen reagieren
Je besser wir verstehen lernen, warum ein Pferd zu schnappen beginnt, desto pferdegerechter können wir reagieren. Schnappt ein Pferd aus Stress, Überforderung, Unsicherheit oder körperlichen Beschwerden heraus, müssen wir anders reagieren, als wenn es wirklich eine Provokation ist (was sehr viel seltener der Fall ist als die meisten annehmen!).
Bis zu einem gewissen Grad müssen wir gerade bei jungen, männlichen Pferden damit leben, dass sie maulaktiv sind. Hier sollten wir auf keinen Fall jedes Schnappen beantworten, sondern uns in Gelassenheit üben. Je mehr wir das Ganze mit Humor nehmen können, desto weniger ernst werden wir reagieren, worauf in der Folge das Pferd auch nicht selbst aggressiv werden wird. Wann immer möglich, raten wir dazu, das Schnappen zu ignorieren. Ist wirklich einmal eine Grenze zu ziehen, sollten wir das so emotionslos wie möglich machen und mit einer authentischen Autorität. Es ist wichtig, nicht wütend zu werden (oder gar zu bleiben), sondern nur ein deutliches Signal zu geben, zum Beispiel mit einer deutlichen stimmlichen Ermahnung.
Ganz wichtig: Sich selbst überprüfen
Bevor wir beim Pferd ansetzen, sollten wir immer zuerst unser eigenes Verhalten überprüfen. Viele Schnappereien sind schlicht und einfach hausgemacht, zum Beispiel durch achtlose Gabe von Leckerlis oder inkonsequentem oder achtlosem Verhalten dem Pferd gegenüber. Viele finden das Schnappen ja eigentlich auch „so süß“ und bestärken ein Pferd damit unbewusst darin.
Tipp: Hier ruhig öfter mal sich selbst im Zusammensein mit dem Pferd filmen und hinterher anschauen, es ist erstaunlich, wieviel einem da oft auffällt.
Gegenseitiger Respekt als Basis
Statt den Fokus auf das Schnappen zu legen, raten wir generell dazu, gegenseitigen Respekt zu erarbeiten. Das geht bei aufdringlichen und rüpeligen Pferden am besten durch Abstand.
Wir merken oft selbst nicht, dass wir einem Pferd ständig zu nahe kommen. Wir suchen die Nähe des Pferdes, weil wir es so lieb haben und weil es so schön zu streicheln und so süß ist, laden es damit aber ungewollt ein, uns selbst eben auch zu nahe zu kommen. Es hat sich unserer Erfahrung nach sehr bewährt, konsequent für einen gewissen Grundabstand zum Pferd zu sorgen, wenn wir neben ihm stehen oder am Boden mit ihm arbeiten. Es gibt hier keine feste Größe, sondern der Abstand ist dann gut, wenn der Mensch unbedrängt vom Pferd sein kann. Je nach Persönlichkeit oder Stimmungslage kann das auch mal gut mehr als eine Armlänge Entfernung sein, denn Pferde sind durch ihre langen Hälse in der Lage, uns sehr schnell sehr nah mit ihrem Maul zu kommen.
Eine Grundregel kann lauten: Je aufdringlicher das Pferd, desto größer der Abstand. Allerdings ist wichtig zu beachten, dass der Abstand nicht dauerhaft gefordert werden sollte, sondern gerade bei anhänglichen Pferden (die oft einfach unsicher sind), gilt es, den Abstand immer wieder selbst zu verkürzen, also zum Pferd hinzutreten, es freundlich anzusprechen oder auch am Hals zu streicheln (möglichst nicht im Gesicht, da man so zum Schnappen geradezu einlädt) und dann wieder für Abstand sorgt. Bei etwas bulligeren Pferden kann es eine gute Übung sein, das Pferd freundlich zu bitten, einen Schritt rück- oder seitwärts zu machen, sonst kann man auch einfach selbst wieder einen Schritt weggehen – aber gut darauf achten, dass das Pferd nicht gleich hinterherkommt!
Wird diese Respekt-Übung neu eingeführt, kann sie zu einer gewissen Geduldsprobe werden, denn es gibt durchaus Pferde, die von sich aus immer und immer wieder den Abstand zum Menschen reduzieren und ihm zu nahe kommen. Hier ist es wichtig, nicht sauer oder gar aggressiv zu werden, sondern ruhig und gelassen zu bleiben und das Spielchen des Pferdes humorvoll zu nehmen.
Das Schnappen in eine Übung leiten
Eine weitere Maßnahme bei sehr maulaktiven Pferden kann sein, sich mit ihnen eine Übung zu erarbeiten. Wir können einem solchen Pferd beibringen, Sachen aufzuheben und darüber das Verhalten ein Stück weit steuern. Pferde lernen meist schnell, wofür es eine Belohnung gibt und wofür nicht und arbeiten entsprechend mit.
Mein Anthony hebt zum Beispiel gerne Dinge auf, was sich als sehr praktisch erweisen kann:

Fazit: Ein Problem wird oft erst ein Problem, wenn wir eines daraus machen
Für das Schnappen, wie für viele andere sogenannte Unarten bei Pferden gilt, dass diese meist erst dann zu einem Problem werden, wenn wir a) nicht bereit sind zu verstehen, warum ein Pferd tut, was es tut, und b) durch unser eigenes Verhalten erst ein Problem daraus machen. Das Verhalten eines Pferdes ist zunächst immer nur als Kommunikation zu sehen und wir sollten uns immer fragen, was es uns sagen will. Dann können wir die Sache zusammen mit dem Pferd lösen, statt es zu bestrafen. Das erweist sich in der Praxis für uns immer wieder als der sinnvollste und beste Weg.























 Am einfachsten haben es sicher diejenigen, die schon in jungen Jahren eine „andere“ als die herkömmliche Herangehensweise im Umgang mit Pferden kennen lernen konnten und deshalb gleich neu- und weniger um-lernen mussten, wie zum Beispiel Carina, die unseren Longenkurs mit 15 entdeckte, hier rechts in der Anfangsphase zu sehen.
Am einfachsten haben es sicher diejenigen, die schon in jungen Jahren eine „andere“ als die herkömmliche Herangehensweise im Umgang mit Pferden kennen lernen konnten und deshalb gleich neu- und weniger um-lernen mussten, wie zum Beispiel Carina, die unseren Longenkurs mit 15 entdeckte, hier rechts in der Anfangsphase zu sehen.  Feedbacks, wie das von Beate: „Du mit deinem Training, Babette, damals noch auf deinem Hof, ganz für mich allein ;-), ganz intensiv und Tania mit ihren Gesprächen, Ihr habt mich im Laufe der Zeit völlig umgekrempelt.“ oder von Helen: „… Irgendwas fehlte da noch für die gute Laufmanier, ich wusste einfach nicht weiter, bis der Tag X kam, ich las einen Bericht von Babette (…), wie die Pferde gesund laufen lernen, an der Longe (…) Ich war sehr begeistert, verschlang buchstäblich alles von ihr und dann probierte ich es aus, und die Pferde liefen einfach viel schöner, auch gerade in der Volte (und nicht mehr auf der Vorhand wie ein Motorrad) konstanter an der Longe, es war kaum zu beschreiben.“ zeigen, dass sich das Umlernen und Dranbleiben wirklich lohnt.
Feedbacks, wie das von Beate: „Du mit deinem Training, Babette, damals noch auf deinem Hof, ganz für mich allein ;-), ganz intensiv und Tania mit ihren Gesprächen, Ihr habt mich im Laufe der Zeit völlig umgekrempelt.“ oder von Helen: „… Irgendwas fehlte da noch für die gute Laufmanier, ich wusste einfach nicht weiter, bis der Tag X kam, ich las einen Bericht von Babette (…), wie die Pferde gesund laufen lernen, an der Longe (…) Ich war sehr begeistert, verschlang buchstäblich alles von ihr und dann probierte ich es aus, und die Pferde liefen einfach viel schöner, auch gerade in der Volte (und nicht mehr auf der Vorhand wie ein Motorrad) konstanter an der Longe, es war kaum zu beschreiben.“ zeigen, dass sich das Umlernen und Dranbleiben wirklich lohnt.