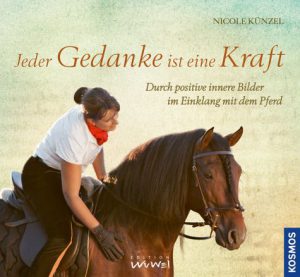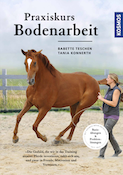In meinen Coachings stoße ich immer wieder auf ein Phänomen, das für große Probleme zwischen Mensch und Pferd sorgt: Während das Pferd im Hier und Jetzt lebt, zieht der Mensch fast ständig Bezüge zu dem, was mal war. Und das hat Folgen.
Mein Pferd ist so und so…
Hier einige typische Äußerungen, die ich oft höre:
- Mein Pferd will immer Boss sein und ist dabei oft respektlos. Erst letzte Woche hat er …
- Die Stute ist normalerweise sehr nervös, die können schon die kleinsten Sachen kirre machen. Neulich am Anbinder …
- Mein Pony ist vollkommen verfressen, da kann ich nicht mit Futterlob arbeiten. Erst gestern hing er mir wieder in der Tasche …
- Mein Wallach ist vollkommen cool, den bringt gar nichts aus der Ruhe …
Und hier die Situationen dazu, in denen die Besitzer/innen das jeweils sagten:
- Das Pferd wartete respektvoll in einem guten Abstand.
- Die Stute stand seelenruhig und fast gelangweilt am Anbinder.
- Das Pony schaute keck, aber machte keinerlei Anstalten näher zu kommen, obwohl ich meine Hand in meiner Jackentasche hatte.
- Der Wallach stand wie eine Statue, fast jeder Muskel war angespannt.
Wir interpretieren die Welt aus dem heraus, was wir erleben
Ich will noch deutlicher machen, worum es mir geht: Für die meisten von uns ist es ganz normal, Erlebtes zu erinnern, und solche Erinnerungen sind für uns oft lange Zeit noch sehr präsent. Wir reden mit anderen über das, was uns passiert ist, erzählen subjektiv interpretierte Geschichten und wir ordnen aus unseren Erlebnissen heraus anderen Lebewesen (ob Menschen oder Tieren) Eigenschaften zu – und, und das ist das Entscheidende, gehen davon aus, dass unsere Schlüsse richtig sind. Denn natürlich kann jeder Besitzer aufgrund der vielen Erlebnisse sein eigenes Pferd doch am besten einschätzen, oder etwa nicht?
Tja, genau um dieses Fragezeichen geht es mir hier.
Wenn ich zu einem Coaching komme, habe ich in der Regel kaum Vorwissen. Ich kenne Pferd und Mensch meist nicht und habe deshalb keine Vorgeschichte mit ihnen. So kann ich mich vollkommen unbelastet auf das einlassen, was gerade ist. Und interessanterweise weicht das IST, das ich wahrnehme, häufig von dem ab, was mir als IST erzählt wird. Denn die Besitzer/innen berichten von Erlebnissen, die sie mit ihrem Pferd hatten und, und auch das ist entscheidend: Sie erzählen von denen, an die sie sich erinnern!
Unsere Erinnerung ist selektiv
Tatsächlich nämlich erinnern wir ja nie alles, sondern nur einen Teil. Denn so arbeitet das menschliche Gehirn: Es registriert vor allem das, was besonders ist, nicht das Gewohnte. Für den Umgang mit Pferden ist das leider nur bedingt nützlich, weil wir uns vor allem an die Sachen erinnern, die unschön waren.
Mal ganz ehrlich: Wir erinnern meist nicht die 95 Prozent, in denen unser Pferd brav alle vier Hufe gegeben hat, sondern wir erinnern die wenigen Momente, in denen es ein Bein weggezogen hat. Wir erinnern nicht die unzähligen Male, in denen unser Pferd in der Halle brav angetrabt ist, sondern wir erinnern die seltenen Momente, in denen es scheinbar aus dem Nichts losschoss. Und wir erinnern uns nicht an all die ungezählten Male, in denen sich unser Pferd auf der Weide problemlos aufhalftern ließ, sondern denken immer wieder an den einen Tag, an dem es weglief und sich nicht einfangen ließ.
Und weil das so ist, sind wir oft ziemlich nachtragend…
Pferde ticken etwas anders
Pferde leben hingegen im Hier und Jetzt. Sie können sich zwar durchaus auch an Vergangenes erinnern, aber in der Regel zählt für sie der Moment, in dem wir zu ihnen kommen. Sie sind in der Lage, immer wieder gleichsam „neu zu starten“. Manchmal spüren wir das, wenn das Pferd plötzlich nichts mehr von dem zu wissen scheint, was es gestern noch prima konnte oder, wenn wir dachten, bei einer Sache endlich einen Durchbruch erreicht zu haben, am nächsten Tag aber doch wieder alles ist wie zuvor. Und wir erleben es immer wieder dann, wenn ein Pferd uns unsere Ungeduld oder Ungerechtigkeiten vom Vortag komplett verziehen hat, denn Pferde können wie kaum ein anderes Lebewesen immer und immer wieder verzeihen.
Hinweis: Natürlich gibt es auch Einzelfälle, in denen die Erlebnisse für das Pferd so schlimm waren, dass es z.B. menschenscheu geworden ist oder aggressiv usw., aber ich gehe hier jetzt mal von einem ganz normalen Pferd aus, nicht von den Extremfällen.
Die Fähigkeit zum Neustart
Diese in Pferden eingebaute Bereitschaft zum Neustart ist eine Herausforderung für uns Menschen und gleichzeitig eine ganz wundervolle Chance, viel zu lernen. Sie stellt uns vor die Aufgabe zu akzeptieren, dass wir, die wir doch so gerne alles sicher im Griff haben, uns auf nicht allzu viel verlassen können, weil sich unser Pferd jeden Tag ein bisschen oder manchmal auch vollkommen anders präsentieren kann. Wer z.B. die Idee hat, einem Pferd nur einmal zeigen zu müssen „wer der Boss“ ist und dann wird es ihm für immer folgen, hat einen ganz wichtigen Aspekt des Pferd-Seins nicht verstanden: neues Spiel, neues Glück.
Pferde werden nie müde, Dinge zu hinterfragen. Für sie gibt es keine in Stein gemeißelten Regeln, sondern alles ist beweglich – so wie auch in einer Herde alles beweglich ist. Auch Leitstute und Leithengst werden in ihrer Position immer mal wieder in Frage gestellt und in der gesamten Rangfolge gibt es untereinander ständig kleinere und größere Verschiebungen. Genauso wie ein Zaun zwar grundsätzlich akzeptiert wird, was aber noch lange nicht bedeutet, dass nicht hin und wieder getestet wird, ob das Tor nicht vielleicht doch offen ist oder ob wirklich Strom drauf ist.
Im Umgang heißt das, dass wir zwar natürlich die Persönlichkeit unseres Pferdes erkennen und einschätzen können, dass aber eben manchmal alles ganz anders sein kann – momenteweise, aber vielleicht auch grundsätzlich, dann nämlich, wenn wir zu sehr aus selektiven Erinnerungen heraus das Verhalten unseres Pferdes interpretieren und deshalb zu Fehleinschätzungen kommen.
Ein offener Blick
Wenn ich zu einem Coaching komme, schaue ich mit offenen Blick hin und fühle mich in das ein, was ist. Deshalb gelingt es mir oft, das Pferd zumindest in diesem Moment etwas klarer zu erkennen als es sein Besitzer vermag, ganz einfach deshalb, weil ich nicht durch den Filter der vergangenen Erlebnisse schaue.
Nun ist es sicher eine Illusion, sich als Mensch im Umgang mit Pferden vollkommen von vergangenen Erlebnissen lösen zu können, denn so funktioniert unser Gehirn einfach nicht. Aber wir können uns bemühen, es ein Stück weit zu üben. Eine Leitfrage, die ich deshalb jedem Pferdemenschen schenken möchte, ist diese:
Was ist jetzt gerade in diesem Moment?
Es ist eine menschliche Schwäche, uns gegenseitig Sachen vorzuhalten und Vergangenes immer wieder hervorzuholen. Von anderen Menschen erwarten wir Entschuldigungen und Verhaltensveränderungen aufgrund von Einsicht. Und genau das übertragen wir dann leider oft auch auf unsere Pferde. Wir nehmen ihnen (manchmal ganz unbewusst) übel, was sie falsch gemacht haben, und setzen deshalb oft an diesen Erfahrungen an, obwohl sie mit der augenblicklichen Situation gar nichts mehr zu tun haben!
Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich klar zu machen, dass wir ein Pferd nicht rückwirkend erziehen können. Ein Pferd wird nicht „einsehen“, dass es doof war, dass es sich gestern losgerissen hat oder dass es nicht hätte scheuen dürfen. Wir können einem Pferd nur immer wieder aufs Neue einen Rahmen bieten, in dem es sich wohl und sicher bei uns fühlt – das ist Aufgabe und Chance zugleich!
Es geht darum, ein Pferd als lebendiges und vielschichtiges Wesen mit seinen Eigenarten anzunehmen. Es geht darum, sich auf das einzulassen, was gerade ist, und nicht z.B. aus der Wut vom vergangenen Tag heraus zu handeln oder mit dem Stolz von gestern heute noch mehr zu erwarten. Pferdegerecht zu handeln heißt, jeden Tag aufs Neue zu schauen, worum es gerade in diesem Moment geht, um dann darauf angemessen zu reagieren.