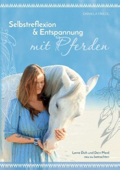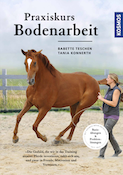Immer wieder erreichen mich Anfragen per Mail, die verschiedene Probleme bei Spaziergängen oder Ritten im Gelände beschreiben: Die Pferde wollen nicht vorwärtsgehen, sind schreckhaft, scheuen und reißen sich manchmal auch los bzw. gehen mit ihrem Reiter auf dem Rücken durch.
Nicht so selbstverständlich, wie vielleicht gedacht
Beim Lesen der vielen Mails wird mir immer wieder klar: Die wenigsten Pferdemenschen machen sich bewusst, dass es für viele Pferde ganz und gar nicht selbstverständlich ist, mit einem Menschen ins Gelände zu gehen. Tatsächlich aber ist das eine große und wirklich schwierige Aufgabe, ganz besonders dann, wenn keine anderen Pferde dabei sind.
So nett die Vorstellung für uns Menschen sein mag, fröhlich und entspannt mit unserem Pferd spazieren zu gehen oder auszureiten, so übersehen wir dabei oft ein ganz wesentliches Element: Pferde sind Herdentiere und in der freien Natur wäre ein Pferd allein leichte Beute. Die Angst eines einzelnen Pferdes im Gelände ist also keine „Spinnerei“ und auch kein „Ungehorsam“, sondern ein von der Natur eingebautes Überlebensprogramm.
Natürlich gibt es viele Pferde, für die es kein Problem ist, alleine ins Gelände mit dem Menschen zu gehen, aber für junge Pferde, für eher unsichere Tiere oder für Pferde mit Trennungsangst (so genannte Kleber) oder schlechten Vorerfahrungen ist es wirklich eine riesige Herausforderung, alleine mit dem Menschen ins Gelände zu gehen. Und je unwirscher der Mensch wird, wenn das Pferd Angst oder Unwillen zeigt, desto mehr wird es sich darin bestätigt sehen, dass das Gelände keine gute Idee ist …
Ein Beispiel zur Veranschaulichung
Nun denken viele Pferdemenschen, dass ihre gute Beziehung zu ihrem Pferd doch ausreichen muss, um dem Pferd die Angst zu nehmen, und sie ihm allein durch ihre Anwesenheit Sicherheit geben können. Dazu einfach mal ein Gedanke von mir aus meiner eigenen Gefühlswelt:
Ich leide unter Flugangst. Wenn eine Person mit mir fliegt, der ich vertraue, wie z.B. meine ältere Schwester, sie meine Hand hält und mir sagt, dass alles gut ist, dann geht es mir auf jeden Fall besser. Es ist tröstlich und schön, wenn sie dabei ist. Aber: Angst habe ich trotzdem, sehr große sogar. Am liebsten würde ich einfach aussteigen oder im übertragenen Sinn: Wäre ich ein Pferd, würde ich mich bei jedem Luftloch loszureißen versuchen, um wegzulaufen – und dass, obwohl ich meiner Schwester vertraue …
An dieser Stelle ist übrigens auch sehr spannend, dass meine Schwester, die sonst keine Probleme im Flugzeug hat, auf dem Flug, bei dem ich mit feuchten Händen und klopfendem Herzen neben ihr saß, selbst auch Angst hatte. Meine Angst hatte sie angesteckt! Und so geht es uns Pferdemenschen doch in der Regel auch, wenn wir mit einem ängstlichen Pferd spazieren gehen, oder nicht? Diese Unsicherheit wiederum spürt unser Pferd ganz genau, was ihm die Sache natürlich noch schwerer macht.
Angst verstehen und akzeptieren
Ich denke, wir müssen verstehen und akzeptieren, dass unser so vermeintlich „kleiner“ Wunsch, mit einem Pferd entspannt ins Gelände zu gehen, nicht mit jedem Pferd einfach so zu realisieren ist, sondern dass die Angst einfach manchmal stärker ist. Ein Stück weit kann man auch solche Pferde ans Gelände gewöhnen, aber man muss jederzeit damit rechnen, dass selbst kleine Auslöser (die manchmal für uns vielleicht nicht einmal zu erkennen sind), die Angst wieder aufkommen lassen.
Auch dazu noch einmal das Beispiel meiner Flugangst: Eine Weile bin ich oft geflogen, weil ich meine Flugangst überwinden wollte. Ich habe in dieser Zeit alle möglichen Übungen gemacht, Klopftechniken und Atemtechniken angewendet und Hörbücher zum Thema Flugangst gehört. All diese Maßnahmen haben erreicht, dass ich die Flüge besser überstanden habe. Es war nicht mehr der blanke Horror und zeitweise konnte ich auf den Flugstrecken sogar gut entspannen. War der Flug aber unruhiger, kam ein größeres Luftloch, veränderten sich die Motorengeräusche deutlich, war die Angst auch ganz schnell wieder da. Ich konnte zwar besser mit ihr umgehen, aber sie war trotzdem da.
Spazieren gehen als Trainingsaufgabe
Es gilt, sich Spaziergänge im Gelände ganz kleinschrittig zu erarbeiten – unter Umständen deutlich kleinschrittiger als die meisten es vielleicht zunächst für nötig halten. Ich sehe es inzwischen so, dass die Übung alleine ins Gelände zu gehen, egal ob an der Hand oder unter dem Reiter, für unsichere Pferde in gewisser Hinsicht noch schwieriger ist als zum Beispiel das Erlernen der Piaffe oder fliegende Galoppwechsel. Bitte setzen Sie also Ihre Erwartungen extrem niedrig an und nehmen Sie dieses Training ernst. Geben Sie Ihrem Pferd die Zeit, die es braucht, um Sicherheit im Gelände erlangen zu können – und das kann bedeuten, dass Sie für den Anfang vielleicht wochenlang nur einmal kurz vor die Tür oder ein paar Meter gehen können!
Merke: „Mal eben eine entspannte Runde ins Gelände zu gehen“, kann bei unsicheren Pferden allenfalls das Endziel, nie aber der Anfangspunkt sein!
Hier noch ein Wort zum Spazierengehen mit Fohlen: Oftmals möchten Pferdebesitzer auch schon mit ihren sehr jungen Pferden spazieren gehen, mit Pferden, die noch unter einem Jahr alt sind. Ich bin grundsätzlich dafür, dass junge Pferde, gerade in der Zeit, in der sie sich in der Sozialisierungsphase befinden, viel von der Welt zu sehen bekommen, aber bitte immer in Begleitung von einer ruhigen, sicherheitsgebenden Begleitung durch andere Pferde, denen das Jungtier vertraut und durch die es Sicherheit bekommen kann. Es ist nicht artgerecht, schon Fohlen an Spaziergänge allein gewöhnen zu wollen, und es kann zu heftigen Gegenreaktionen kommen, oft auch dann, wenn das Fohlen erst ganz ruhig erscheint.
Denken Sie daran: Es geht hier sowohl um die Sicherheit Ihres Pferdes als auch um Ihre eigene. Pferde, die sich im Gelände losreißen bzw. durchgehen, sind eine große Gefahr. Wenn Sie die Angst Ihres Pferdes nicht ernst nehmen und Ihr Pferd überfordern, laufen Sie Gefahr, dass diese Angst immer größer und damit unter Umständen auch unkontrollierbarer wird.
Und so können Sie praktisch vorgehen
Am besten nutzen Sie für das Spaziertraining einen weichen, gut gepolsterten und gut passenden Kappzaum. Dieser ermöglicht Ihnen, den Kopf des Pferdes gut zu kontrollieren, was wiederum mehr Sicherheit bedeutet.
Üben Sie zunächst auf einem sicher eingezäunten Platz das Führen des Pferdes, so dass Ihr Pferd die Grundkommandos zum Antreten und Anhalten sicher verstanden hat und sich brav, ohne zu drängeln oder zu überholen von Ihnen führen lässt.
Tipp: Üben Sie parallel kleine Lieblingsspiele mit Ihrem Pferd. Das könnte zum Beispiel die Übung Kopf tief, das Tanzen oder Bein hoch sein.
Gehen Sie mit Ihrem Pferd dann einige Male einfach nur „vor die Tür“, also durch das Stalltor hindurch und lassen Sie es sich umgucken. Verwöhnen Sie es mit etwas Leckerem und achten Sie gut darauf, dass Ihr Pferd entspannt bleibt. Sollte es sich hier bereits gestresst und aufgeregt zeigen, gilt es, erst das so lange zu üben, bis das Pferd in dieser Situation gelassen sein kann. Hier kann die Anwesenheit eines ruhigen Pferdes, für das das Rausgehen bereits Routine ist, sehr helfen.
Erst wenn das „Vor die Tür gehen“ eine lockere Angelegenheit ist, beginnen Sie mit den ersten „kleinen Spaziergängen“, die nur wenige Minuten dauern sollten! Je nach Unsicherheit des Pferdes können sogar schon einige Schritte vollkommen ausreichen. Schätzen Sie Ihr Pferd bitte gut ein, damit es möglichst erst gar nicht zu Stress und Angst kommt. Ein ruhiges Pferd als Begleitung kann bei diesen ersten kleinen Ausflügen für viel Ruhe und Sicherheit sorgen.
Gehen Sie also mit Ihrem Pferd ein kleines Stück vom Hof weg und machen Sie kurz ein paar Übungen, die Ihr Pferd gerne und zuverlässig ausführt. Loben Sie diese Übungen sehr, drehen Sie wieder um und gehen Sie gleich wieder nach Hause. Hat das gut geklappt, können Sie die Spaziergänge in kleinen (!) Schritten etwas verlängern. Wenn Ihr Pferd diese kleinen Spaziergänge als Routine empfindet und dabei wirklich gelassen ist, probieren Sie, auch mal ohne Begleitpferd ein kleines Stückchen zu gehen.
Wird Ihr Pferd zu unsicher und zeigt es Stress oder Angst, ist es noch nicht reif für Spaziergänge alleine ins Gelände. Dann probieren Sie es weiter erst einmal nur mit Begleitung.
Wichtig: Gerade in der Pubertät oder auch im Frühling oder an stürmischen Tagen kann es leicht dazu kommen, dass Pferde, die eigentlich schon recht gelassen im Gelände waren, wieder in alte (Angst- und Stress-)Muster zurückfallen. Erspüren Sie deshalb möglichst vorher, ob der jeweilige Tag tatsächlich ein guter Tag fürs Gelände ist und verzichten Sie ggf. lieber einmal mehr auf den Spaziergang bzw. halten Sie ihn kurz, als dass es wieder zu heftigen Angst-Reaktionen kommt, die Sie im Training dann erst einmal wieder deutlich zurückwerfen.
Tipp: In unserem Anti-Angst-Kurs erfahren Sie, wie Sie mit den Ängsten Ihres Pferdes besser umgehen können. Auf der Basis, die Sie sich im Anti-Angst-Kurs mit Ihrem Pferd erarbeiten, haben Sie sehr gute Chancen, ein gelassenes Gelände-Pferd zu bekommen.
Fazit
Ich glaube, dass wir die oft so angstbesetzte Aufgabe „Spaziergang“ auf eine Weise erarbeiten und trainieren können, durch die die meisten von unseren Pferden die Erfahrung machen können, dass ein Spaziergang im Gelände eigentlich eine tolle Sache ist. Die Pferde werden durch ein positives, kleinschrittiges Training sicherer und gelassener und damit auch selbstbewusster. Bei dem einen Pferd geht das schneller, bei vielen dauert es aber länger und letztlich gibt es immer auch Pferde, die leider nie wirklich ganz gelassen und angstfrei allein im Gelände sein werden.