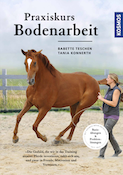Alles hängt zusammen – die Sache mit den Faszien
„Faszien“… – ein Begriff, der seit einiger Zeit immer wieder zu lesen und zu hören ist. Da Anatomie nicht ganz mein Steckenpferd ist, habe ich mich zunächst ziemlich schwer damit getan, mich an dieses Thema heranzuwagen. Aber je mehr ich darüber las und hörte, desto mehr bekam ich den Eindruck, dass das Thema wichtig ist. Und so bat ich unsere Fachfrau für solche Fälle, nämlich Maike Knifka, Osteopathin und Physiotherapeutin für Pferde, um Aufklärung.
Das Ergebnis präsentiere ich Euch in drei Stufen:
- Als Kurzfassung gleich hier im Blog für alle, die sich vor allem für die Bedeutung für den praktischen Alltag interessieren.
- Als kleinen Film, in dem Maike die Sache ausführlicher und anschaulich erklärt.
- Und als Fachtext von Maike, der in die Tiefe geht.
Zusammengefasst sind Faszien das, was man bisher unter dem Bindegewebe verstand, diese beiden Begriffe können synonym verwendet werden. Allerdings ist die alte Vorstellung des Bindegewebes als eine Art Hülle inzwischen überholt, denn die Faszien sind keine oberflächliche „Schicht“, sondern sie durchziehen einen Körper wie ein dreidimensionales Netzwerk bis hinein in die Tiefe. Damit halten die Faszien einen Körper nicht nur zusammen, sondern tatsächlich ermöglichen und organisieren sie die Bewegung. Darüber hinaus sind Faszien mit Rezeptoren versehen und können so Schmerzimpulse direkt an das Gehirn weitergeben; sie wirken also zusätzlich wie ein Sinnesorgan.
Die Quintessenz, die ich nun aus den Fakten für mich gezogen habe, ist folgende:
Alles ist
miteinander verbunden.
Das ist von der Sache her nicht neu, aber sich das wirklich einmal klarzumachen, hat Folgen für den Umgang mit auftauchenden Problemen: Viel zu oft betrachten wir unser Pferd gleichsam in Einzelstücken, also sprechen von einer „Blockierung im Genick“, von einer „Verspannung im Hals“ oder von einer „Lahmheit hinten links“. Und damit greifen Maßnahmen und Behandlungen oft viel zu kurz.
Der Organismus als Netzwerk
Wenn man sich bewusst macht, dass so ein Körper eben gerade nicht in Einzelteilen, sondern viel mehr wie ein dreidimensionales Netzwerk organisiert ist, in dem alles mit allem zusammenhängt, dann macht es einfach keinen Sinn, ein Symptom allein zu betrachten oder zu behandeln.
Es gibt also keinen einzelnen verspannten Muskel und keine einzeln zu lokalisierende Blockierung, die gelöst werden kann, sondern es muss geschaut werden, welche Verbindungen es zu vielleicht ganz anderen Bereichen im Pferdekörper gibt und was unter Umständen noch alles behandelt oder geändert werden muss, damit wirklich die Ursache für Beschwerden gefunden und nicht nur am Symptom herumgedoktert wird.
Probleme immer ganzheitlich angehen
Und DAS ist für mich das, was wir als Pferdebesitzer und Laien in Sachen Physiologie verstehen müssen: Unser Pferd muss, bei welchen Problemen auch immer, als Ganzes betrachtet und ggf. auch behandelt werden.
Praktisch heißt das:
- Lahmt mein Pferd in der Hinterhand, reicht es in den meisten Fällen nicht aus, nur den Tierarzt eine Lahmheitsuntersuchung an dem entsprechenden Bein machen zu lassen, sondern ich brauche eine Fachperson, die bereit und in der Lage ist, mein Pferd ganzheitlich zu untersuchen und z.B. darauf kommt, dass das Problem von einem verspannten Kiefer oder schlechten Zähnen oder noch ganz woanders herkommen kann.
- Schlägt mein Pferd mit dem Kopf, so muss mir klar sein, dass das z.B. auch durch einen unpassenden Sattel oder fehlerhafte Einwirkungen beim Reiten ausgelöst werden kann – ich muss also bereit sein, alles zu überdenken, was ich mit dem Pferd tue.
- Buckelt mein Pferd beim Reiten, so kann auch das alle möglichen Ursachen haben und ich darf es nicht einfach nur als Unart bestrafen. Auch hier muss ich bereit sein, alle möglichen Faktoren zu berücksichtigen, die meinem Pferd Schmerzen oder Unwohlsein bereiten können.
- Will mein Pferd nicht vorwärts laufen, können dafür massive körperliche Probleme der Grund sein, wie z.B. Atemprobleme, Magengeschwüre, Huffehlstellungen und vieles andere mehr – und nicht, wie so oft angenommen, „Faulheit“ oder „Sturheit“. Ich muss hier bereit sein, nicht einfach nur frustriert oder wütend zu sein, sondern mich dafür zu öffnen, dass es unter Umständen echte Probleme gibt, die ich noch nicht erkannt habe.
- Und so weiter und so fort…
Es reicht also nicht aus, einzelne Symptome herauszunehmen und vielleicht punktuell eine Massage vorzunehmen oder eine andere Behandlung, sondern wir müssen den zugegebenermaßen sehr komplexen Gedanken zulassen, dass der Körper als Ganzes erkannt und behandelt werden muss – … und, als ob es noch nicht genug ist, dürfen wir darüber hinaus auch die Psyche nicht vergessen, denn sie gehört mit dazu.
Was heißt das für den Alltag?
Ich verstehe inzwischen besser, warum ich mich so schwer damit tat, mich mit diesen Faszien zu befassen, denn hier lauert das, was vielen von uns Angst macht und was vor allem auch massiv lähmen kann und das ist die Komplexität.
Wie oft habe ich mich schon hilflos gefühlt, weil ich zwar sah, dass mein Pferd ein Problem hat, ich aber keine Ahnung hatte, wie ich herausfinden soll, was wirklich die Ursache ist! Es erscheint so viel einfacher und machbarer, sich mit einzelnen Symptomen zu befassen und diese zu behandeln, weil man das Gefühl hat, das in den Griff bekommen zu können. Und so ist es menschlich verständlich und nachvollziehbar, dass wir nur oft allzu bereit sind, uns auf einzelne Symptome zu stürzen und ja, manchmal auch aus Not heraus dem Pferd lieber Unwillen und Widersetzlichkeiten unterstellen, als uns damit zu befassen, dass es Schmerzen oder andere körperliche Probleme hat, die wir einfach nicht einordnen können. Aber – und das ist unsere Verantwortung als Pferdehalter – wir müssen auch begreifen, dass dieser scheinbar „einfachere“ Weg eben leider oft nicht sinnvoll ist, im Gegenteil: er kann zu viel Leid führen, denn die Zusammenhänge verändern sich ja nicht dadurch, dass ich sie nicht wahrhaben will.
Das Wichtigste, das ich an dieser Stelle weitergeben möchte, ist wieder einmal die Botschaft, dass jedes Verhalten eine Ursache hat und dass wir unserem Pferd bei Bockigkeit, Dominanz oder Ähnlichem keinen bösen Willen unterstellen dürfen, wenn es die Mitarbeit verweigert oder sich Beschwerden zeigen. Wir sollten IMMER davon ausgehen, dass das Pferd einen Grund hat, und wir müssen auf seiner Seite stehen und nicht gegen es handeln, nur weil es uns zu unbequem ist oder wir uns hilflos fühlen.
Wie bleibe ich handlungsfähig?
Aber, wie bleibe ich nun angesichts dieser enormen Komplexität handlungsfähig, wenn doch alles mit allem zusammenhängt und ich letztlich eigentlich nie genau wissen kann, wo ich überhaupt anfangen soll?
Ich denke, der einzige Weg ist der, akzeptieren zu lernen, dass vieles nicht sofort erfassbar und vor allem nicht sofort zu beseitigen ist. Es kann schon viel helfen, den Zeitdruck herauszunehmen und bei Problemen keine Sofort-Lösung zu erwarten. Wenn wir den Zeit- und den Erwartungsdruck herausnehmen, können wir uns mit einem Thema in Ruhe befassen, uns hineinfühlen, achtsam werden, uns selbst schlaumachen und nach kompetenter Hilfe suchen, wohl wissend, dass es nicht auf alles eine Antwort geben wird.
Ich habe oft den Eindruck, dass wir mit einem ziemlich mechanistischen Weltbild auf unsere Mitlebewesen (und auch uns selbst!) schauen und erwarten, dass man Probleme einfach reparieren kann. So aber funktioniert Leben eben (leider?) nicht. Das zu verstehen und dazu bewusst ja zu sagen, ist für mich ein unerlässlicher Schritt geworden, um die Komplexität meiner Verantwortung als Pferdebesitzerin auszuhalten und um bessere Entscheidungen für mein Pferd treffen zu können.
Und die Sache mit den Faszien finde ich inzwischen sogar recht spannend. 🙂
Und hier geht es zu dem Film mit Maike und hier findet Ihr den Fachtext von ihr.

8. Januar 2018 von Tania Konnerth • Kategorie: Anatomie und Körper, Erkenntnisse, Gesundheit, Verhalten • 4 Kommentare »



 Foto von Horst Streitferdt
Foto von Horst Streitferdt


 Auslöser für die Aufregung in diesem konkreten Fall: Ich hatte körpersprachlich einen kleinen Fehler gemacht, worauf Dreamer – vollkommen korrekt – abwendete und die Richtung wechselte. In der nächsten Runde achtete ich besser auf meine Körpersprache, aber er wendete dennoch an derselben Stelle ab, wohl davon ausgehend, dass ich das wieder wollen würde. Obwohl ich lachte merkte er sofort, dass nun er einen Fehler gemacht hatte und das ließ seinen Stresspegel sofort hochschnellen.
Auslöser für die Aufregung in diesem konkreten Fall: Ich hatte körpersprachlich einen kleinen Fehler gemacht, worauf Dreamer – vollkommen korrekt – abwendete und die Richtung wechselte. In der nächsten Runde achtete ich besser auf meine Körpersprache, aber er wendete dennoch an derselben Stelle ab, wohl davon ausgehend, dass ich das wieder wollen würde. Obwohl ich lachte merkte er sofort, dass nun er einen Fehler gemacht hatte und das ließ seinen Stresspegel sofort hochschnellen.